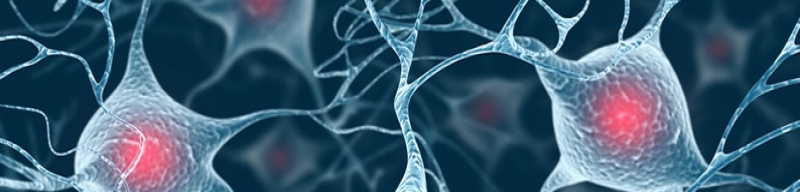Notizen aus der Provinz: „Gehen uns die Ärzte aus?“ lautete neulich die Frage irgendwo auf dem flachen fränkischen Land beim Diskussionsabend zu eben diesem Thema. Gleich zu Beginn wollte jemand
aus dem Publikum vom Herrn aus dem Bayerischen Gesundheitsministerium wissen, wie sich denn die Zahl der Medizin-Studienplätze entwickelt habe? „Das habe ich nicht parat, aber …“ sprach der Beamte und leitete einen etwa
zehnminütigen, diffusen Monolog ein, in dem er viel sprach aber nichts sagte. Nach dem verwirrenden Sermon konnte unsereiner die gewünschte Antwort liefern: 1989 – im letzten Jahr vor der Wiedervereinigung – gab es in der
BRD West 85.901 Medizinstudenten.
Signifikanter Rückgang
Es folgte die Wiedervereinigung, mit ihr kamen acht ostdeutsche medizinische Fakultäten dazu und die Zahl der Einwohner stieg von etwa 60 Millionen in Deutschland West auf ungefähr 80 Millionen
in Gesamtdeutschland. Die Zahl der Medizinstudenten hingegen sank (!) in Gesamtdeutschland bis zum Wintersemester 2007/08 auf 78.545. Zum Wintersemester 2013/14 war sie allmählich auf 86.376 angestiegen und befand sich damit
in etwa auf dem westdeutschen Niveau vor dem Mauerfall. Interessant am Rande war die überraschende Erkenntnis, dass der bei der Diskussion anwesende Herr Bundestagsabgeordnete diese Zahlen sehr wohl „parat“ hatte! In
einem späterer Redebeitrag verplapperte er sich ein wenig. Von sich aus hatte sich der Volksvertreter nicht bemüßigt gefühlt, exakte Angaben zu liefern. Warum wohl?
Keiner weiß, warum
Auf die Frage, weswegen denn die Zahl der Medizinstudenten so stark reduziert worden sei, wusste niemand eine Antwort. Meine Erläuterung: Ein einziger angehender Mediziner kostet
den Staat bis zum Ende seines Studiums 180.000 bis 200.000 Euro. Ein Jurist hingegen nur 20.000 bis 25.000 Euro. Die Priorität, die der „schwarzen Null“ in den Haushalten eingeräumt wird, kann Menschenleben kosten,
was billigend in Kauf genommen wird.
Interessant die Beiträge der Kommunalpolitiker, die berichteten, wie „schwer bis unmöglich“ es jetzt schon sei, auf dem flachen Land neue Hausärzte in die Niederlassung
zu locken. Als Lösung war von „positivem Denken“ (ja, wirklich!) die Rede, von ärztlicher Seite wurden Kontaktanknüpfungen für Arztinteressenten an den örtlichen Motorradclub, den Anglerverein etc. etc. empfohlen.
Den Geschenkkorb mit regionalen Spezialitäten nicht zu vergessen. Tatä und Helau! Geht’s noch armseliger?
Frauen in der Überzahl
Also, jetzt mal Klartext – und der hat auf besagter Veranstaltung weitgehend gefehlt: Warum gehen uns die Ärzte aus, wie die oben angeführten Zahlen der Medizinstudenten beweisen?
Signifikant ist die Abbruchquote während eines Medizinstudiums: Zu meiner Zeit (Herbst 1978 bis Frühjahr 1985) fast Null, inzwischen ca. 20 Prozent. Diesen Faktor eingerechnet, werden etwa 70.000 von den jetzigen Medizinstudenten
ihr Abschlussexamen ablegen.
Stichwort Frauenanteil im Medizinstudium: Mädchen machen im Schnitt das bessere Abitur, und das wirkt sich natürlich in einem Numerus-Clausus-Fach wie Medizin auf das Geschlechterverhältnis
der Studenten aus. Zwei Drittel aller Medizinstudenten sind inzwischen weiblich. Nun werden Ärztinnen zurecht viel mehr Wert darauf legen, Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen als Ärzte. Sie haben Gott sei Dank oft
das Verlangen, eine Familie zu gründen – und möchten zugleich den Beruf halbtags ausüben. Dazu gibt es Berechnungen der Kassenärztlichen Vereinigungen, denen zufolge drei (!!) Teilzeit-Ärztinnen erforderlich sein werden, um die
60-Wochenstunden-Job eines einzigen „hauptamtlichen“ Hausarztes zu übernehmen. Die Zahl der Wochenarbeitsstunden pro Arzt in der Niederlassung wird also deutlich sinken und damit auch das Versorgungsangebot. Gehen
wir überschlagsmäßig davon aus, dass etwa die Hälfte der jetzigen weiblichen Medizinstudenten nur halbtags arbeiten wird. Zwei Drittel Medizinstudentinnen, davon die Hälfte ist ein Drittel. Die arbeiten nur halbtags,
also muß man die Zahl von 70.000 Medizin-Absolventen um 1/3 mal 1/2 (halbtags) = 1/6 vermindern. Es verbleiben – umgerechnet auf ganztags – etwa 58.000 Mediziner.
Demotivierende Aussichten
Der Beruf des Arztes ist inzwischen demotivierend wie kaum ein anderer. In den Kliniken lernen die Nachwuchskräfte anhand des Fallpauschalensystems, dass die Gesundheit der
Klinikbilanz weit über der Gesundheit des Patienten steht. Die Folge: Etliche junge Ärzte wandern in die Forschung, den Medizinjournalismus, die Pharmaindustrie etc. ab, statt sich in die Patientenversorgung einzubringen.
Laut Bundesärztekammer liegt die Zahl der Ärzte, die nicht der Versorgung der Bevölkerung in Klinik und Praxis zur Verfügung steht, bei etwa neun Prozent. 58.000 Ärzte minus neun Prozent macht rund 53.000 Ärzte für
die Patientenversorgung. Bei durchschnittlich 13 Semestern Studiendauer „liefern“ die deutschen medizinischen Universitäten demnach ungefähr 8.200 Studenten pro Jahr, die – umgerechnet auf ganztags – zur Ausübung des
Arztberufs zur Verfügung stehen.
Zurzeit versorgen in Deutschland laut Bundesärztekammer ca. 358.000 Ärzte die Patienten. Unter der (für die Versorgung sehr günstigen) Annahme, dass ein Arzt seinen Beruf
in Klinik und Praxis durchschnittlich vierzig Jahre lang ausüben kann, ergibt sich ein jährlicher Nachwuchsbedarf von 8.950 Ärzten. Das sind deutlich mehr als die oben errechneten 8.200, die von den Universitäten abgehen.
Schon hier klafft also eine Lücke.
Ärzteschar ist überaltert
Die niedergelassene Ärzteschaft ist überaltert, etwa ein Drittel aller Praxisärzte kommt in den nächsten zehn Jahren ins Rentenalter. Zugleich steigt wegen des demographischen
Wandels mit dem Anstieg des Durchschnittsalters der Behandlungsbedarf in der Bevölkerung, denn leider gilt: älter = kränker. Die oben errechnete „Unterdeckung“ von ungefähren 700 Ärzten pro Jahr ist viel zu
niedrig gegriffen, wenn man die Altersstruktur der Ärzte und die Altersentwicklung der Bevölkerung betrachtet.
In der Niederlassung erfahren die Ärzte andauernd, dass sie nicht so arbeiten können, wie sie eigentlich möchten. Denn erstens sind sie in ihren Leistungsmöglichkeiten für
Kassenpatienten durch ein Honorarbudget beschränkt, zweitens müssen sie damit rechnen, einen Teil ihrer Medikamentenverordnungen selber zu bezahlen, wobei es oft um Summen im unteren fünfstelligen Euro-Bereich geht. Von
solchen Verordnungsregressen ist tatsächlich jeder dritte niedergelassene Mediziner betroffen. Viele sind frustriert, weil sie dauernd in dem Gefühl leben müssen, den Patienten eigentlich besser helfen zu können, dies aber nicht
zu dürfen.
Die Folgen der von der Politik erzwungenen Mangelmedizin bekommen die Patienten im vollen Umfang zu spüren. Sie richten sich in ihrem Zorn aber meist nicht an Politiker oder
Krankenkassen, die Regresse verursachen, sondern gehen auf die Ärzte los. „Ärztebashing“ ist eine neudeutsche Spezialität und treibt die Kollegen entweder in die Resignation mit der Folge einer fehlenden Motivation
in der Berufsausübung oder ins Ausland. „In der Schweiz werde ich wieder wertgeschätzt“, hat mir neulich ein Kollege geschrieben…
Nicht können oder nicht wollen?
Ob die Politik die eigentlichen Probleme, die zum Ärztemangel führen, nicht erkennen kann oder nicht erkennen will, sei dahingestellt. Bis jetzt betreibt Bundesgesundheitsminister
Gröhe wie seine Vorgänger nur Maßnahmen, die die Attraktivität des Arztberufes weiter vermindern: Zum neuen „Versorgungsstrukturgesetz“ habe ich mich bereits geäußert (sh. Aufsatz „Tolles Versorgungsstrukturnetz“),
ebenso wie zur geplanten Anpassung der Gebührenordnung für Privatpatienten nach 19 Jahren mit unveränderten Preisen um lächerliche sechs Prozent (sh. „Rücktritt Montgomerys geboten“). Übrigens, so nebenbei
und unter uns: die Bezüge der Bundestagsabgeordneten haben im gleichen Zeitraum um 49 Prozent zugelegt.
Nichts hilft wirklich
Resümee: Die ärztliche Versorgung hat bereits erheblichen Schaden gelitten, das kann jeder Bürgermeister in kleinen Landgemeinden bestätigen. Davon ist übrigens nicht nur
die hausärztliche Versorgung betroffen, sondern auch die fachärztliche. Machen Sie den Test: Rufen sie in einer Praxis für Neurologie und Psychiatrie an und bitten um einen Termin: Na, in wie vielen Monaten können Sie
kommen? Wenn die Politik nicht schnellstens gegensteuert und den Arztberuf wieder attraktiv macht, dann wird Carsten Vilmars Prophezeiung vom „sozialverträglichen Frühableben“ bald zum Faktum für die Menschen
hier im Land.
Und die Ärzte selbst? Was unternehmen die gegen das eigene Mangelproblem? Ein weitgehend schweigender Arztfunktionär von der Kassenärztlichen Vereinigung und ein naiv-bemühter
Kollege, der das Konzept mit der Kontaktanbahnung zum Anglerverein und dem Präsentkorb für interessierte Kollegen vorgestellt hat, machen es überdeutlich: Nichts, was wirklich helfen würde.