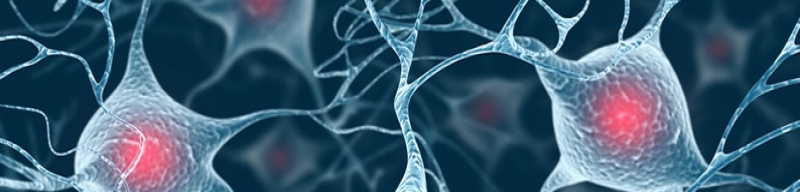Stundenlange Wartezeiten in Notaufnahmen von Krankenhäusern selbst für Patienten, bei denen es wirklich eilt? Neulich kam die Kieler Uniklinik in die Schlagzeilen, weil Hirninfarktpatienten drei bzw. fünf Stunden warten mussten, bis sich ein Arzt ihrer annahm. Politiker jedweder Couleur reagierten pflichtschuldig entsetzt, versteht sich.
Auf eine Veröffentlichung im Ärzteforum „Hippokranet“ hin berichtete ein Kollege von seinem Vater, der 24 Stunden nach der Aufnahme in einem Großkrankenhaus an seinem schwachen Herzen verstarb, ohne bis dahin gründlich untersucht, geschweige denn behandelt worden zu sein. Netto-Aufenthalt in der Notaufnahme: siebeneinhalb Stunden. Ein anderer Kollege ergänzte: Nach Einweisung unter dem Verdacht auf eine Hirnblutung habe es in einer süddeutschen Klinik fünf Stunden gedauert, bis ein Patient untersucht worden sei.
Was sind die Ursachen solcher Missstände?
Die Mängel-Hitparade
1. Rationierung der ambulanten Medizin, also der Praxen. Will heißen: Pro Quartal gibt’s nur einen bestimmten Geldbetrag für die Behandlung aller Kassenpatienten, und der ist so knapp bemessen, dass er nie und nimmer ausreicht. Folge: Circa ein Drittel der Patienten, die in Kliniken eingewiesen werden, könnten rein medizinisch in den Praxen gut versorgt werden. Weil Arbeit ohne Lohn allerdings in den Ruin treibt, werden aufwendige Patienten in Krankenhäuser delegiert und tragen so zu deren Überlastung bei.
2. Ärztemangel, zwar auch schon in den Praxen, aber vor allem in den Kliniken, die ja einen Teil der ambulanten Arbeit stationär aufs Auge gedrückt bekommen (siehe 1). Und Ärztemangel geht allein auf das Konto der Politik! 1989 – im letzten Jahr vor dem Mauerfall – gab es in der BRD West 85.901 Medizinstudenten.
Es folgte die Wiedervereinigung, mit ihr kamen acht ostdeutsche medizinische Fakultäten dazu und die Zahl der Einwohner stieg von etwa 60 Millionen in Deutschland West auf ungefähr 80 Millionen in Gesamtdeutschland.
Steigender Bedarf, sinkende Studentenzahlen
Die Zahl der Medizinstudenten hingegen sank (!) in Gesamtdeutschland (!) bis zum Wintersemester 2007/08 auf 78.545. Zum Wintersemester 2013/14 war sie allmählich auf 86.376 angestiegen und befand sich damit in etwa auf dem westdeutschen (!) Niveau vor dem Mauerfall. Warum konnte es zu so einer drastischen Reduzierung kommen? Die Antwort ist simpel. Ein Medizinstudent kostet den Staat bis zum Examen fast zehn Mal so viel wie ein Jurastudent und immer noch fast viermal so viel wie ein Ingenieurstudent.
Medizin ist das mit Abstand teuerste Studium. In Zeiten leerer Staatskassen wurde halt gespart. Dumm nur, dass die Bevölkerung dank der vermaledeiten Ärzte immer älter und mit zunehmendem Alter immer kränker wird, was wiederum mehr Mediziner erfordert. Das medizinische Paradoxon sozusagen. Ärzte in den Kliniken fehlen, nicht nur auf Station, sondern auch in der Aufnahme.
3. Die Anspruchshaltung mancher Patienten. Klar, wenn es im Brustkorb plötzlich heftig zieht, ist die Idee nicht schlecht, sich von einem Familienmitglied schnellstmöglich ins nächste Krankenhaus fahren zu lassen. Könnte ja wirklich ein Herzinfarkt sein. Allerdings: „Ich hab seit vier Wochen Rückenschmerzen und grade mal etwas Zeit – könnte der Arzt mal nachsehen?“ passt beim besten Willen nicht zu einer Not(!!!)Aufnahme. Dennoch tummeln sich gerade solche Zeitgenossen dort zuhauf und stehlen Doktoren Zeit für Patienten, die ernsthaft krank sind.
Profit geht vor Sorgfalt
4. Fehlanreize im Kliniksystem: Geld wird an der Klinik nicht mit der sorgfältigen Diagnose und gründlichen Behandlung von Patienten verdient, sondern mit dem Stellen möglichst vieler Diagnosen, die alle einzeln vergütet werden. Außerdem natürlich mit möglichst vielen Operationen. Alles andere ist aus kaufmännischer Sicht nichts wert – schon gar nicht die Gesundheit des Patienten. Die kommen oft genug kränker als vorher nach Hause.
Behandeln, Heilen gar, bringt ja kein Geld. Die Politik hat auf die Gesundheitsökonomen gehört, die Krankenhäuser arbeiten nach wirtschaftlichen Geboten wie eine Fabrik, da ist Ausschuss eben eine ökonomische Größe. Jener Patient jedoch, der als „Ausschuss“ die Klinik wieder verlässt, belastet das ambulante System. Meistens nicht lang, denn er wird bestimmt wieder eingewiesen. Natürlich über die Aufnahme, in der er stundenlang verweilt. „Drehtürpatient“ nennt man ihn in Fachkreisen.
Ökonomen dirigieren Politiker
Die Gesundheitsökonomen geben vor zu wissen, was gut ist fürs Gesundheitssystem. Die Politik setzt um, was sie vorgeben. Unterm Strich zählt nur noch die Gesundheit der Bilanz, nicht mehr die des Menschen.
Lösungen liegen auf der Hand: Abschaffung der ambulanten Budgets, Steigerung der Medizinstudenten, Zuzahlungen für die Patienten bei missbräuchlicher Inanspruchnahme der Notaufnahmen, Änderung des Abrechnungssystems der Krankenhäuser. Warum aber wird sich nichts ändern? Weil es die Gesundheitsökonomen von der Bertelsmann-Stiftung und andernorts halt besser wissen und weil die Politiker weiterhin brav auf niemand sonst hören. Der Karren wird konsequent weiter und tiefer in den Dreck geschoben.
Oder hat irgendjemand den Eindruck, dass die gesundheitliche Versorgung in Deutschland in den letzten 20 oder 30 Jahren wirklich besser geworden ist? Der medizinische Fortschritt bei Technik und Medikamenten? Oh ja. Aber das Arzt-Patienten-Verhältnis? Das Zwischenmenschliche? Das einander vertrauen können? Wo ist das geblieben? Das ist keine wirtschaftlich kalkulierbare Größe, das haben die Damen und Herren Gesundheitsökonomen eben wegrationalisiert.